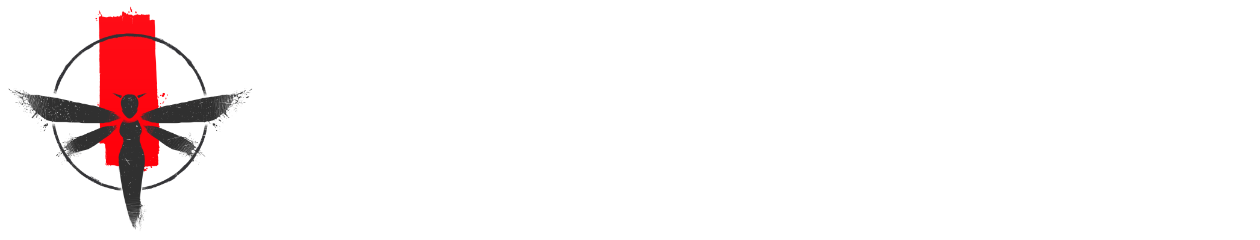Ich wohne praktisch mitten im Naturpark. Ein erster, langer Spaziergang trägt mich stundenlang durch Wälder, über weiche Pfade, an allen Wassern entlang. Sie sehen aus wie große Seen und sind doch irgendwie das Meer. Sie sind überall, teilen und begrenzen völlig frei, wie es ihnen gefällt. Hier und dort ist nicht dasselbe. Manchmal braucht es eines großen Wassers, um diese Einfachheit zu begreifen. An Gärten und Villen vorbei, an Teichen, unter den Augen von Gans und Buntspecht, an Felsrücken, die grün und grau und glatt zum Berühren einladen, an Moos und Brücken.
Später, Cornflakes, Tee und Kaffee kaufen, Milch nicht vergessen, dann Deutsche, Asiaten und Schweden auf dem Flur treffen. Langsam weicht auch das Gefühl, dass ich etwas Verbotenes tue, wenn ich die fremde, große Küche benutze, meine Milch in die fremden Kühlschränke stelle, aus fremden Tassen trinke. Langsam wird das Stockwerk mein Zuhause. Ich treffe drei Chinesinnen und beschließe, dass ich sie mag. Sie haben sich englische Namen ausgesucht, damit niemand ihre chinesischen Namen aussprechen muss. Wir essen gemeinsam und ich mag sie immer noch. Sie sind überrascht, dass ich Wei Hui und Mian Mian gelesen habe. Ich lächle mein erstes chinesisches Lächeln.
Schwedisches Wohnheim
Ich ziehe in ein schwedisches Wohnheim ein, meine Bettwäsche passt zufällig zum Überzug des Schreibtischstuhls. Sein altmodisches und irgendwie ekliges Grün sieht dadurch plötzlich nicht mehr altmodisch und eklig aus. Eher nach Frühling, denke ich. Ich bin etwas durchgequirlt und müde, Flugreisen gehen immer viel zu schnell. Ich meide die anderen Studenten, heute will ich keinen Wirbel mehr im Kopf, nur noch Ruhe. Keine Gespräche, kein holpriges Schwedisch, keine Staus, keine Flugzeuge, kein Geld ausgeben und kein Gepäck schleppen. Keine grinsenden Busfahrer, keine netten Flugbegleiterinnen und vor allem keine neugierigen Studentengesichter.
Vor meinem Fenster habe ich etwas, eine Aussicht, eine ganz passable Aussicht sogar. Ich sehe weiter als ich gewagt hatte zu hoffen, bis zu den Kuppeln des Reichsmuseums, bis zum Wald gegenüber, bis zum Mond. Als ich am Fenster stehe, sieht ein junger Mann zu mir hoch, ich stehe im Licht einer milchigen Nachttischlampe, üppige weiße Vorhänge links und rechts. Weil er schaut, sehe ich mich selbst am Fenster stehen. Als die Musik beginnt, fange ich beinah an zu weinen.
Finanzviertel verboten
Nicht zu fassen. Heute habe ich tatsächlich wie ein normaler, vernünftiger Mensch zu Mittag gegessen. Tomate, Mozzarella und Kräuterbaguette. Zugegeben, das ist ausbaufähig. Aber egal. Was ich eigentlich schreiben will, ist Folgendes.
Letzte Woche, zwar fielen die Temperaturen nachts bis auf ein paar wenige Grad, verschlug es einen Fotografen und mich wieder in die Stadt. Die erste Frühlingsluft und die Gewissheit, dass ich bald wieder abreise, trieben uns zur abendlich kühlen Aktfotografie. Wie geplant, im Bankenviertel von Stuttgart.
Gut beleuchtet und protzig liegen also die Bankgebäude vor uns, strahlen und schimmern wie poliert. Perfekt. Es weht ein wenig zu kühl fürs Nacktsein, aber ich weiß, dass ich das ein oder zwei Stunden durchhalte. Nach nur siebzehn Aufnahmen werden wir unterbrochen. Ein Wachmann. Ich trage zum Glück, oder vielleicht war es auch Pech, gerade den Mantel des Fotografen. Fotografieren und Filmen, heißt es von Seiten des Wachmanns, sei auf dem gesamten Bankgelände verboten. Er beäugt währenddessen unsere Requisiten, einen Putzeimer, Besen, einen Motorradhelm, die Thermoskanne, und meine Beine. Raffinierte Gangster oder ziemliche Spinner, denkt er vielleicht. Oder er denkt gar nichts, weil er solche Hampelmänner öfter sieht. Nein, eigentlich sieht er aus, als habe er das Denken auf später verschoben und mache jetzt erstmal seinen Job. Das nehme ich ihm nicht einmal übel. Sachlich und knapp verweist er uns des Ortes. Ich hätte ihn noch gerne nach dem Grund des Verbotes gefragt, er schaut aber so finster, deshalb lasse ich es. Die Banken sind also, denken wir, wenigstens für diesen Abend, gestorben. Es werden imposante, leuchtende Riesen gebaut und keiner darf sie fotografieren.
Zuflucht, denn Aufgeben war keine Option, fanden wir, nach kurzer Fahrt, bei Daimler Benz. Reflektierender Lack, große Scheiben, Holzterrasse, nicht schlecht. Die Temperatur war noch auszuhalten. Auf der Holzterrasse standen aufgepumpte Geländewagen, hinter den Scheiben teures Blech in vielen anderen Formen. Hätte nur diese eine silberne Karosse noch etwas näher am Fenster gestanden! Sollten wir den Pförtner vielleicht fragen, ob er uns möglicherweise diesen einen Wagen … drei Meter nach vorn? Ja, dorthin. Wunderbar, danke.
Wir beschlossen, unser Glück nicht auf die Probe zu stellen. Hundert Bilder später und zehn gefühlte Grade kälter, wurde ich zurück nach Tübingen verschifft. Ich war müde, viel zu müde für diese Uhrzeit, und schlief wie ein Stein.
Der geneigte Leser möge sich bei Interesse ein paar der Bilder selbst ansehen. Ihr wisst ja, wo.
Mein rotes Leben
Am Tag nach der Blutspende ein Glas Wein zu trinken ist durchaus eine andere Erfahrung als gewöhnlich. Zumindest, wenn die eigene Körpermasse nicht hinreicht, um als ordentlicher Alkoholverteiler zu dienen. Mir schwindelt und ich bleibe lächelnd sitzen. Als Erstspender ist überhaupt die ganze Prozedur eine Erfahrung. Nadeln, Flüssigkeiten und mein rotes Leben, dem ich beim Rinnen zusehen kann. Es ist unheimlich.
Danach, der Beutel ist ganz warm, ich darf ihn anfassen. Mein Arm tut ein bisschen weh beim Beugen, aber das ist in Ordnung. Den Verband trage ich gerne für ein paar Stunden, so wie sich Kinder gegenseitig Verbände anlegen, gerne, für ein paar Stunden.
Mein Gefühl bestätigt sich, dass dieser Körper nur geliehen ist. Ich stecke so ganz darin, liebe sein Sichtbares und Unsichtbares, darf alles mit ihm machen, was ich will. Das ist herrlich. Trotzdem, letztlich werde ich ihn wohl wieder abgeben. Mein Blut gehört nicht mir, würde eine Dame aus meinem allernächsten Umfeld sagen. Meine Stimme gehört nicht mir, würde sie hinzufügen und insgeheim gen Himmel schielen, ob dort nicht ein Gott wartet, sie kurzer Hand in seinen rosafarbenen Cadillac zu packen.
Taschenmesser und Ohrstöpsel
Die Taschenmesser teilen sich die Schublade mit den Ohrstöpseln. Eine jener kleinen Schubladen ist es, kubisch, in die ohnehin nicht mehr als ein paar Taschenmesser und vier Packungen Ohrstöpsel passen. Warum gerade die Taschenmesser und die Ohrstöpsel sich dort treffen, ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich haben sie ungefähr denselben Stellenwert bei mir. Ich brauche sie manchmal, eher selten, dann aber dringend. Drei Schubladen höher wohnt das Tuschefass.