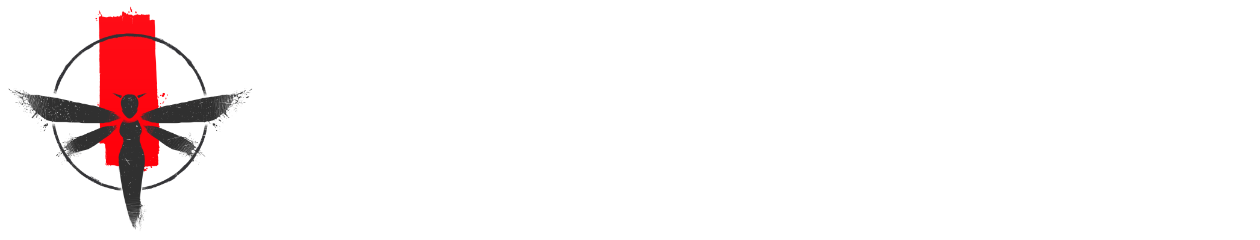Sommerferien, Gartenarbeit bis zum Schwindelanfall, ich schlafe bei offenem Fenster, höre die Menschen feiern bis zum Morgen. Übers Grün hinweg klimpern die Gläser, Rufe verwaschen zu Stimmbokeh. Wollte ich hinübergehen, einen Fuß verschlafen vor den anderen setzen, mich den Feiernden anschließen, so wie ich letzten Herbst in die Reste einer Frankfurter Buchmesseparty geriet, der Weg wäre nur eine halbe Zigarettenbrenndauer weit. Jeden Tag der Kaffee, die Zeitung und ein bisschen mehr die Frage, ob eine Reise in die Vereinigten Staaten langsam als Elendstourismus bezeichnet werden könnte. Freilichttheater, Altmühlsee und Iller, Sport, Spritztouren und Sonnencreme, schließlich zurück an die Arbeit. Ich bade im Tuschefass, bis eine Geschichte daraus hervorwächst, mir über den Kopf und ins Haar hinein. Eine Krähe krächzt durchs Fenster, erinnert mich, dass ich bald wieder den Koffer packe. Island, Reykjavik, ein neuer Weltenwechsel, mein tuschebekleckstes Hirn ist voller Neugier und Polarkreisträume.
Möwensabber
Die Fähre auf die Insel, der Moment, wenn die Autoreifen über die Metallrampe poltern, wenn ich die Zweifel auf dem Festland zurücklasse, den Kalender, die Literaturfestivals und die Erdbeerfelder auch. Tage voller Meerschaum, ich grüße haarige Raupen, Dünenkaninchen, und lasse mir von Möwen die Hände vollsabbern. Ich surfe, bekomme vom Sturm sandgestrahlte Haut, singe laut, der Wind reißt mir die Silben von den Lippen. Später habe ich Sandkörner im Mund und nicht nur dort. Der quirlige Wassersaum, ein Streifen aus Muscheln weiter oben am Strand, die Leute folgen den Linien, die das Meer gemalt hat. Zurück in ihren Wohnzimmern gucken sie Nachrichten und Serien, wir schauen stattdessen James Comeys und Jeff Sessions‘ Vernehmungen, lauschen den unterschiedlichen Akzenten der Senatoren. Knallgelbe Kopfhörer, Wollmütze, Surfcafé, die Flut ist mein Freund und Quallen sind ein Symptom des Meeres.
Der Surfer …
Eindrücke vom Tübinger Bücherfest
Tübinger Bücherfest 2017
Gleich zwei Lesungen gibt es auf dem Tübinger Bücherfest am 27. Mai 2017: um 16:30 Uhr die legendäre Stocherkahnlesung, Ablegestelle ist am Hölderlinturm. Es empfiehlt sich, die Karten zuvor zu buchen.
Auch die Nachtlesung um 21:30 Uhr hinter der Stiftskirche verspricht idyllisch zu werden. Mehr Infos und Kartenvorverkauf auf der Seite des Bücherfestes … Vorfreude!